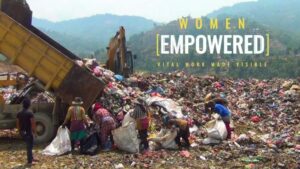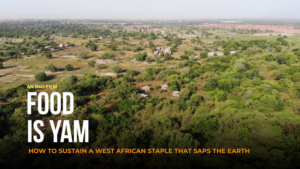Schalt’ das Radio ein: Strategien für fruchtbarere afrikanische Böden
ORM4Soil steht für «Organic Resource Management for Soil Fertility». Soil Fertility, die Fruchtbarkeit des Bodens, befindet sich also im Zentrum. Das Problem einer geringen und abnehmenden Bodenfruchtbarkeit ist in weiten Teilen Afrikas akut. Es zieht immer weniger Nahrungsmittelerträge und eine immer grössere Erosionsanfälligkeit der Böden nach sich. Der Hauptgrund ist, dass viele Bäuerinnen und Bauern ihren Böden zu viele Nährstoffe entziehen, ohne ausreichend für Humus-Aufbau zu sorgen. Mineraldünger helfen da höchstens kurzfristig. Sie ernähren vor allem die Pflanzen, aber nicht die Böden.
Es gibt bekannte und bewährte Methoden, die die Abnahme der Bodenfruchtbarkeit stoppen oder sogar umkehren können. Techniken, die sich für die Bauersleute auch finanziell oder punkto Arbeitsaufwand lohnen. Denn Christoph Spurk, Leiter des ORM4Soil-Kommunikationsclusters, sagt: «Wir wussten, dass jede neue Technik in der einen oder anderen Form rentabel sein muss. Sonst wird sie von der kleinbäuerlichen Bevölkerung nicht übernommen.»

Bild 1: Bauersleute aus Sege in Ghana hören während ORM4Soil-Feldversuchen aufmerksam zu
Den Boden füttern
Es sind keine neuen Methoden, aber sie werden gerade in Afrika noch zu wenig genutzt. Die Beigabe von Kompost ist eine, das Abdecken des Bodens mit Ernterückständen, das sogenannte Mulchen, eine andere. Letztere kühlt den Boden bei Hitze und verhindert Erosion. Eine weitere, gut erprobte Möglichkeit ist die Stickstoffdüngung mittels Leguminosen wie Bohnen oder Erbsen. In Mischkulturen mit Getreidepflanzen wie Mais oder Hirse ziehen Leguminosen in Symbiose mit Bakterien Stickstoff aus der Luft in den Boden, wo er von den Wurzeln der Getreidepflanze als Dünger aufgenommen werden kann. Ähnlich wirkt in der Agro-Forstwirtschaft der Einsatz bestimmter Bäume und Sträucher, die oft in Reihen zwischen die Hauptpflanzen gesetzt werden. In den Boden eingearbeitet dienen ihre Blätter als Stickstoffquelle.
Warum wenden nicht mehr afrikanische Kleinbäuerinnen und -bauern diese die Bodenfruchtbarkeit verbessernden Methoden an? Welche Faktoren bestimmen, ob sie sich auf etwas Neues einlassen, etwas wagen? Antworten auf diese Fragen suchte ORM4Soil in Mali und Ghana in Westafrika sowie in Sambia und Kenia im Südosten des Kontinents. In jedem Land wurden zwei Gegenden untersucht, in jeder Gegend 300 zufällig ausgewählte Kleinbauern interviewt. Insgesamt 2’400 Personen.
Enormer Datenpool
Sie wurden 2016 ein erstes und 2019 ein zweites Mal befragt. Dazwischen fanden Interventionen mittels Radiosendungen, Feldtagen und Aktivitäten der Beratungsdienste statt. Das Paneldesign zeichnet die ORM4Soil-Studie besonders aus. Es macht individuelle Veränderungen (oder auch Konstanz) erkennbar. So waren die Forschenden erstaunt, dass es bei vielen der Techniken auch Aussteiger gab, also Landwirte, die eine Technik 2016 angewendet hatten, aber 2019 nicht mehr. «Davor waren wir sicher, die Bauern und Bäuerinnen würden die Techniken beibehalten, wenn sie nur einmal damit angefangen haben», so Christoph Spurk.
Unter einer Vielzahl an Faktoren, die von den ORM4Soil-Forschenden in multivariaten statistischen Modellen analysiert wurden, zeigte die individuelle Innovationsbereitschaft einer Person den stärksten Einfluss darauf, ob sie eine neue Technik übernimmt. «Die Daten zeigen, dass diejenigen Bauersleute, die schon vorher einmal neue Pflanzen oder eine neue Technik ausprobiert haben, viel stärker als die anderen dazu neigen, eine neue, bodenfruchtbarkeitsverbessernde Technik auszuprobieren», so Christoph Spurk, der an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur lehrt. Diesen Faktor habe die Forschung bis jetzt übersehen. Der Bildungsgrad einer Person, ihr Alter oder Geschlecht – Faktoren, die bisher meistens als wichtig erachtet wurden – zeigten in der ORM4Soil-Untersuchung hingegen keinen Effekt.

Bild 2: Selfie der Doktorandin Becky Baah-Ofori mit Professor Godfred Ofosu-Budu im Obuoba Radiostudio in Ghana
Die Ohrwurm-Methode
Radiosendungen, die sich speziell an landwirtschaftliche Akteurinnen und Akteure richten, sind in Afrika verbreitet. Die afrikanischen ORM4Soil-Partner (Forschende und Beratende) besuchten solche Sendungen, wo sie über die Problematik der abnehmenden Bodenfruchtbarkeit sprachen und – angepasst an die geografischen und kulturellen Rahmenbedingungen der jeweiligen Region – ganz konkrete Tipps gaben, was sich dagegen tun lässt. In jeder Region wurden mehrere halb- bis ganzstündige Sendungen ausgestrahlt und wiederholt.
«Die aus unserer Sicht erfolgreichste Radiosendung mit der grössten Wirkung wurde in Sambia ausgestrahlt», erinnert sich Medienwissenschaftler Christoph Spurk. Es habe sich um einen qualitativ guten, lokalen Sender mit einem kompetenten, kenntnisreichen Radio-Moderator gehandelt. Der Kommunikationsexperte ist überzeugt, dass die Qualität einer Radiosendung und die landwirtschaftlichen Kenntnisse der Moderierenden dabei eine Schlüsselrolle spielen. «Leider ist die Qualität vieler landwirtschaftlichen Radiosendungen in Afrika ungenügend», sagt er, «vielen Moderierenden fehlt leider das Wissen, um aufschlussreiche Fragen zu stellen.» Nach der Sendung in Sambia stellte Christoph Spurks Team in dieser Gegend eine Verbreitung der organischen Düngung mit sehr hohen Anteilen an Viehmist fest. Genau das hatten die Forschenden am Radio empfohlen.
Widerspruch lähmt
Doch Mischkulturen mit Leguminosen hatten in derselben Gegend kaum zugenommen, obwohl auch sie in der Radiosendung erwähnt wurden. Die Analyse zeigte, dass andere, widersprüchliche Botschaften dieser Technik im Wege stehen. So propagiert etwa die in dieser Gegend weit verbreitete Lehre der «Conservation Agriculture», die auch von der FAO gefördert wird, den Einsatz von Herbiziden. Aber Herbizide und Leguminose in Mischkultur schliessen sich gegenseitig aus.
«Das ist eine der bislang wichtigsten Erkenntnisse», so Christoph Spurk. «Bauern und Bäuerinnen sind vielen, zum Teil widersprüchlichen Botschaften unterschiedlicher Akteure ausgesetzt. Darunter auch solche, die das Problem der Bodenfruchtbarkeit negieren». Auch propagieren viele Beratungsdienste den Einsatz von Mineraldüngern, obwohl dieser gerade auf stark ausgelaugtem Boden das Problem sinkender Bodenfruchtbarkeit nicht mehr beheben kann. «Es ist naiv zu glauben, dass Bauern und Bäuerinnen nur die richtigen Informationen erhalten», sagt Christoph Spurk.
“Die Bauersleute sind vielen, zum Teil widersprüchlichen Botschaften unterschiedlicher Akteure ausgesetzt.“
Christoph Spurk, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
Der nationale ORM4Soil-Koordinator in Ghana, Godfred Ofosu-Budu, war selbst Gast in Ghanas Radiosender Obuaba. Er erinnert sich: «Radio ist gut, wenn Bäuerinnen und Bauern die präsentierte Technik bereits kennen und sofern es keine widersprüchlichen Botschaften gibt». Dennoch bevorzugt er landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater, die die Bauern vor Ort besuchen: «Das Radio kann die physische Demonstration einer Technologie oder die reale Interaktion zwischen Landwirten und landwirtschaftlichen Beratern nicht ersetzen“, ist der Professor für Agrarwissenschaften an der Universität von Ghana überzeugt.
„Das Radio kann die physische Demonstration einer Technologie und reale Interaktionen zwischen Bauersleuten und landwirtschaftlichen Beratenden nicht ersetzen.”
Godfred Ofosu-Budu,Universität Ghana
«Radio allein bewirkt noch keine Verhaltensänderung», relativiert auch Christoph Spurk. Letztlich brauche es die Kombination verschiedener Kanäle und möglichst viele Wiederholungen einer Botschaft. Je mehr Kanäle, umso besser. Das Forschungsteam differenziert 15 verschiedene, von Radio, Fernsehen oder Internet bis zu Nachbarschaftsgesprächen und Landwirtschaftsmessen. «Noch besser wäre eine öffentliche Debatte. Nur hie und da mal eine Botschaft reicht nicht aus, um Verhalten zu ändern. Erst wenn viele einen Diskurs führen, werden sie für ein Thema sensibilisiert und merken, dass etwas getan werden muss.»

Bild 3: Eine Bäuerin inspiziert ORM4Soil-Feldversuche in Tharaka-Nithi in Kenia
Erfolg motiviert
Auch die Erfahrung der eigenen Wirksamkeit ist wichtig. «Die Daten in einigen Regionen zeigen, dass Bäuerinnen und Bauern mehr für die Bodenfruchtbarkeit tun, wenn diese sich bereits wieder in eine positive Richtung entwickelt» erzählt der Forscher. «Eine negative Tendenz dagegen führt oftmals eher zu Resignation und Untätigkeit.»
Die Untersuchungen zeigen, dass – ausser in Mali, das grösstenteils in der Sahelzone liegt – viele Bauern und Bäuerinnen noch gar kein Problembewusstsein für die abnehmende Bodenfruchtbarkeit haben. «Vielleicht muss erst eine bestimmte Schwelle der Degradation überschritten sein», mutmasst Christoph Spurk. Er wünscht sich: «Es wäre wichtig, unter den Bauersleuten gezielt Basiswissen über die Böden aufzubauen.» Denn es zeigte sich, dass diejenigen Landwirte in der ORM4Soil-Studie, die über korrektes Wissen über Böden verfügten, widerstandsfähiger gegen widersprüchliche und manchmal falsche Botschaften waren und sich eher für die Bewirtschaftung der Bodenfruchtbarkeit engagierten.
Faktoren, die die Umsetzung von Forschungswissen in der Praxis fördern
Die individuelle Innovationsbereitschaft der Person: Je höher, desto besser. Die Bildung ist irrelevant.
Wiederholung der Botschaft über verschiedene Kanäle, optimalerweise ein breiter öffentlicher Diskurs.
Klare Botschaften, keine widersprüchlichen Empfehlungen von anderen Akteuren.
Die Veränderung gibt den Betroffenen einen kurzfristigen Nutzen (Geld und/oder Arbeitsaufwand).
Erfolgserlebnisse – die Wahrnehmung von Verbesserung und Wirksamkeit – verstärken die Motivation,
weiterzumachen. Die Wahrnehmung einer Verschlechterung führt dagegen eher zu Resignation.
Omnipräsentes Radio
Radio ist das afrikanische Massenmedium schlechthin. Dies gilt auch für die Kleinbauern und -bäuerinnen in ländlichen Regionen, wie die erste ORM4Soil-Umfrage zeigte. 90 Prozent der ländlichen Bevölkerung lassen sich über den Äther erreichen, während es via Fernsehen maximal ein Viertel und via Internet weit weniger als 5 Prozent sind (auf dem Land!). Viele Bauern tragen ein Radio bei sich, wenn sie irgendwo draussen arbeiten. Und da jedes Mobiltelefon auch ein Radioempfänger ist, hat es die Reichweite des Mediums noch vergrössert.
Related Posts
The Green Vein: Agroecology Rising in West Africa
WOMEN EMPOWERED: Vital Work Made Visible
Sources
Kontakt:
Christoph Spurk, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Schweiz, skcp@zhaw.ch.
Projekt:
ORM4Soil: Farmer-driven Organic Resource Management to Build Soil Fertility (Mali, Ghana, Zambia, Kenya);
https://www.orm4soil.net/orm-home.html; http://www.r4d.ch/modules/food-security/building-soil-fertility
Bilder von:
Christoph Spurk und Becky Baah-Ofori.
Englische Version des Artikels hier.