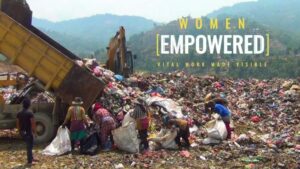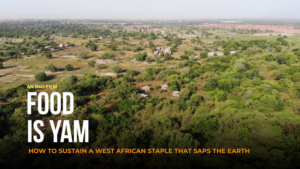Ansätze für eine nachhaltige Palmölproduktion
Bis zu 50 Kilogramm schwer werden die Fruchtstände der Ölpalme, die die Bauern in tropischen Breiten das ganze Jahr ernten. Das Palmöl ist aus der Küche Südostasiens, Indiens, Afrikas, Mittelamerikas und immer mehr auch Chinas nicht mehr wegzudenken. In vielen Regionen ist es kulturell verankert. Mit dem Bevölkerungswachstum steigt auch die Nachfrage. Zudem wurde Palmöl, nebst anderen Pflanzenfetten in den vergangenen Jahrzehnten von verschiedenen Industriesektoren entdeckt, um Lebensmittel geschmeidig, Kosmetika angenehm und Treibstoffe gefrierfest zu machen. So hat es auch in den Industrieländern einen festen Platz eingenommen. Das gepriesene Wundermittel hat jedoch das Image des Umweltzerstörers und Klimatreibers. Wie von einer potenten Droge sei die Welt von Palmöl abhängig geworden, titelte unlängst der Guardian.
«Die westliche, industrialisierte Welt reduziert die Produktion und die Verwendung auf ein einziges, simples Narrativ», sagt John Garcia-Ulloa. Dass die Ölpalme und ihr Öl in unterschiedlichen kulturellen und naturräumlichen Kontexten eine nachhaltige Lebensgrundlage ermöglicht, gehe in der Diskussion unter. Der Ökologe von der ETH Zürich sucht mit Forschungspartnern aus verschiedenen Disziplinen nach Lösungen, wie die Ölpalme für Mensch und Umwelt auf der ganzen Welt nachhaltiger angebaut werden kann.
«In jedem Land führen unterschiedliche Rahmenbedingungen zu unterschiedlichen Problemen, aber auch Lösungen», sagt Garcia-Ulloa. Um die komplizierten Wirkungsketten und die Handlungsmöglichkeiten der verschiedenen Akteure zu erforschen, wenden die Wissenschaftler Computersimulationen, Brett- und Rollenspiele an. Die Erkenntnisse sind verblüffend, die Nähe von Forschung und Entscheidungsträgern vielversprechend.
In drei Ländern haben die Forschenden zusammen mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft Abhängigkeiten, Gestaltungs- und Lösungsmöglichkeiten hin zu einer nachhaltigeren Palmölproduktion erarbeitet. Drei Beispiele aus drei Kontinenten zeigen wir hier auf.
Indonesien: Ursache liegt in den Landbesitzverhältnissen
Der Druck auf den Regenwald ist enorm: Um die grosse Nachfrage auf dem Weltmarkt, vor allem aus Indien und China zu bedienen, werden riesige Flächen für Ölpalm-Plantagen gerodet. Brennender Regenwald prägt das Bild, das wir im Westen mit Palmölproduktion gleichsetzen. Eine Ursache für die grossflächige Rodung und die katastrophalen ökologischen Auswirkungen der Palmölproduktion sind die Landbesitzverhältnisse in Indonesien und Malaysia. Die Rechtsstruktur bringt Unsicherheiten über Grundbesitz mit sich. Grundbesitz ist jedoch eine Voraussetzung, um ein Label für nachhaltige Produktion zu erlangen. Diese Rahmenbedingungen und die aktuellen Geschäftsmodelle begünstigen Grossproduktionssysteme und erschweren den Aufbau von kleineren ökologisch «smarten» Plantagen. Eine Reform der Landrechte und der Geschäftsmodelle wäre laut den Forschenden in Indonesien und Malaysia der Weg zu einer nachhaltigeren Produktion.

Bild 1: Riesige Flächen mit Ölpalmen prägen das Landschaftsbild in Südostasien und in den Köpfen von Schweizer Konsumenten/-innen.
Kamerun: Verluste in kleinen, veralteten Produktionsanlagen
In der Heimat der Ölpalme sorgen viele kleine Betriebe für das Rohmaterial. Die lange Anbautradition, die archaischen Verarbeitungsmethoden und die wirtschaftlichen Strukturen führen zu Produktionsverlusten. Viele Bauern verkaufen die Früchte an lokale, verlustreich produzierende Anlagen. Die ineffiziente Produktion und die damit verbundenen Preisschwankungen führen zusätzlich zu Importen von Palmöl und zur Abhängigkeit vom Weltmarkt. Die komplizierten Zusammenhänge zeigt eine Animation des OPAL-Projekts. Den wirksamsten Handlungsspielraum in Kamerun sehen die Forschenden in effizienteren Produktionsanalagen, in der Entwicklung neuer landwirtschaftlicher Technologien sowie in innovativen sozialwirtschaftlichen Partnerschaften.

Bild 2: Veraltete Verarbeitungsmethoden und die wirtschaftlichen Strukturen führen zu Produktionsverlusten in Kamerun.
Kolumbien: Konkurrentin um knapper werdendes Wasser
80 Prozent des Agrarlands in Südamerika wurden durch Waldrodungen gewonnen. In Kolumbien wächst die Ölpalme auf grossen Flächen. Stark schwankende Niederschläge zwischen Regen- und Trockenzeit gehören hier zu den grossen Herausforderungen für die gewinnbringende Palmölproduktion. Die Ölpalme braucht das ganze Jahr über genügend Wasser. In der Trockenzeit konkurriert sie mit dem Anbau für Nahrungsmittel wie Reis und Bananen, mit der Viehhaltung und dem Naturschutz. Lösungsmöglichkeiten sehen die Forschenden in einer übergreifenden Landschafts- und Wassernutzungsplanung, verbesserten Bewässerungssystemen, Wiederaufforstung und Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen.

Bild 3: Palmöl, Vieh oder Naturschutz: Jahreszeitlich stark schwankendes Wasserangebot ist die grosse Herausforderung in Kolumbien.
Related Posts
The Green Vein: Agroecology Rising in West Africa
WOMEN EMPOWERED: Vital Work Made Visible
Sources
Kontext:
Dieser Beitrag basiert auf Forschungsresultaten des Projekts «Oil Palm Adaptive Landscapes» (OPAL), finanziert vom r4d-Programm:
http://www.opal-project.org
Kontakt:
John Garcia-Ulloa
john.garcia@usys.ethz.ch
Institut für Terrestrische Ökosysteme
ETH Zürich, Universitätstrasse 16, CH-8092 Zürich